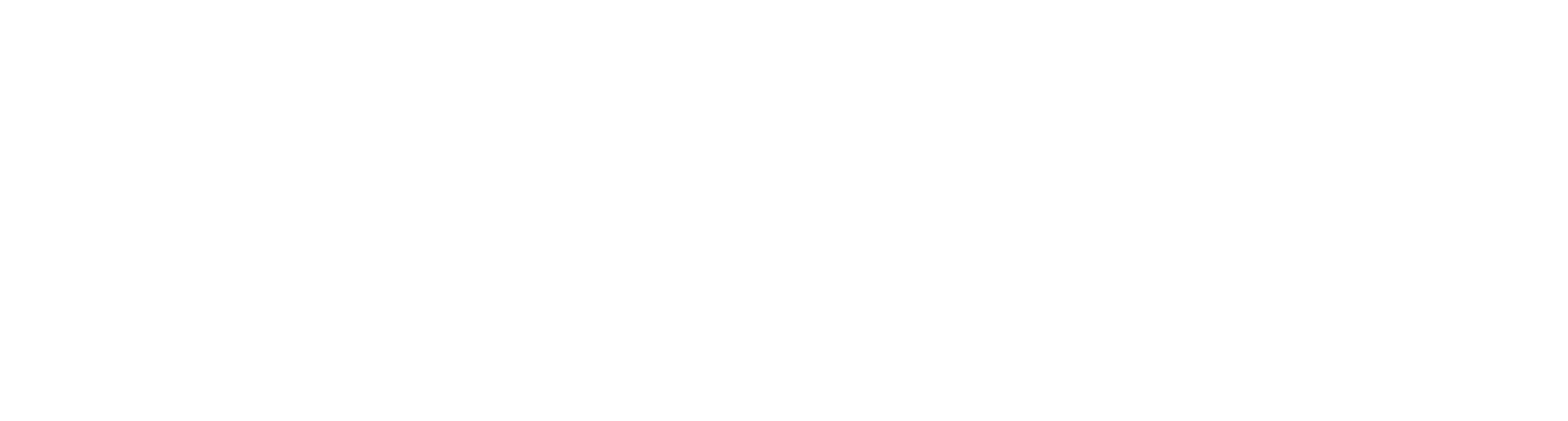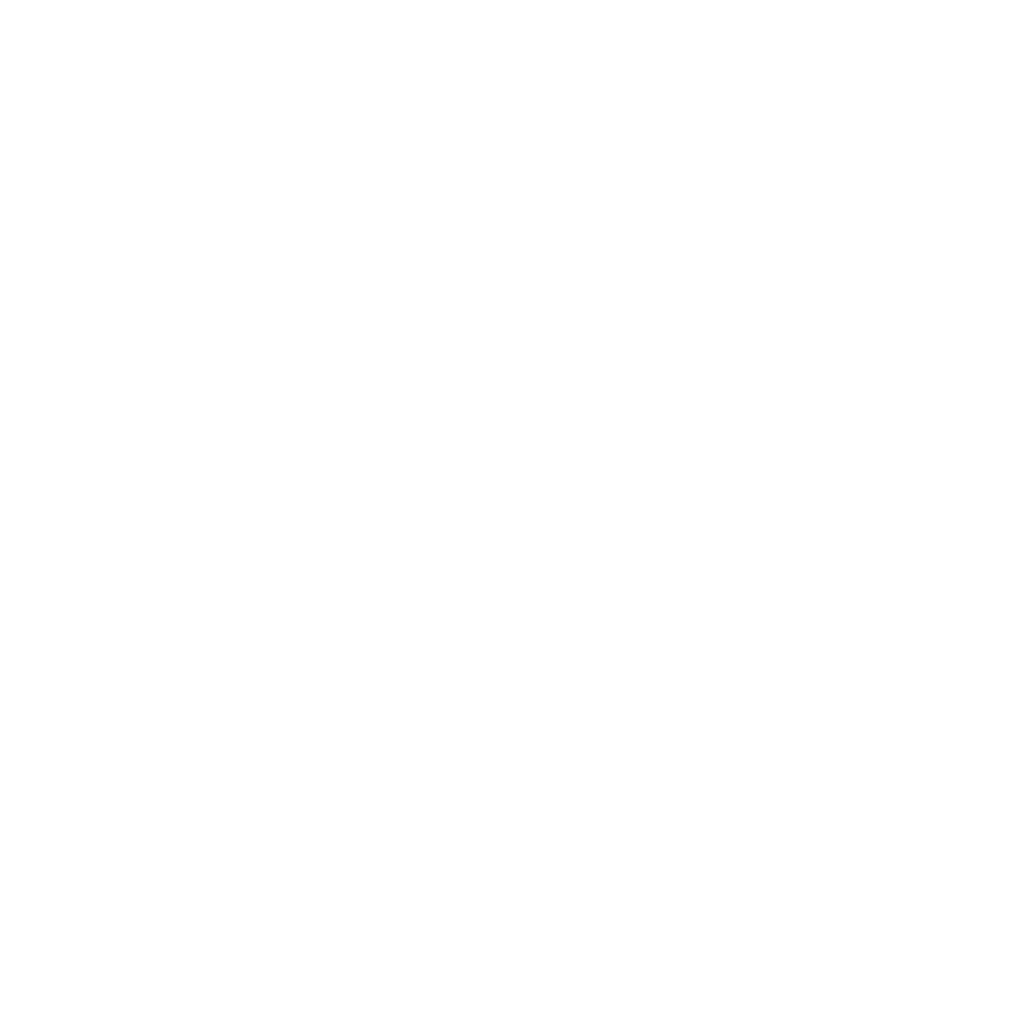Eine Dörcherfamilie in Tirol
Diese Kopie des Holzstiches von M. Schmid wurde im Nachlass von Romedius Mungenast als Teil eines Briefes entdeckt.
Mit einigen wenigen Ausnahmen fand das halb-nomadische Dasein der Jenischen im Zuge des letzten Jahrhunderts ein gewaltsames Ende (→ Dossier: Verfolgungsgeschichte). Vor dieser Zäsur jedoch zählte das unstete, an Karren und Rucksäcken gebundene Leben der Fahrenden für lange Zeit zum bekanntesten Merkmal dieser Bevölkerungsgruppe. Für gewöhnlich war man nur in den warmen Jahreszeiten unterwegs, jenische Familien hatten ein festes Winterquartier. Dieses Quartier befand sich häufig in der Ortschaft, in der die Familie auch das sogenannte Heimatrecht besaß (→ Dossier: Heimatrecht, Romehen und Zwang zur Sesshaftwerdung).
Unbedingt warmherzig war der Umgang mit den Jenischen nicht immer: in der Regel wollten keine „anständigen“ sesshaften Bürger:innen sie in der Nachbarschaft haben. Wie es bei vielen marginalisierten Gruppen der Fall ist, wurden auch die Jenischen nicht nur metaphorisch aus der Mitte der Gesellschaft gedrängt: Die Wohngebäude der Fahrenden befanden sich häufig auf unwirtlichen, abseits gelegenen Gemeindegründen – eben dort, wo es keinen landwirtschaftlichen Nutzen gab oder man in schlechten Zeiten auch mit lebensgefährlichen Katastrophen wie Schlammlawinen, Steinschlägen oder Hochwasser zu rechnen hatte. Im Tiroler Oberland wären die Inn-Auen oder Schottergruben eiszeitlicher Endmoränen Beispiele für solche Gebiete.
Heute kaum vorzustellen, aber vor knapp einem Jahrhundert war der Anblick fahrender Menschen noch Teil des Alltags (→ Dossier: Gesellschaftsstruktur). Mit Ende März, Anfang April wurde bei den jenischen Familien dann vielerorts der Hund oder das Pferd vor den Karren gespannt, in den meisten Fällen aber musste ein Familienmitglied das Ziehen des Wagens übernehmen. Dabei kamen die Jenischen mitunter ganz schön herum – in Bayern etwa galt der Ausdruck „Tyroler“ als Bezeichnung für fahrendes Händlervolk, die Jenischen waren also im wahrsten Sinne des Wortes „Kulturträger:innen“.
Auch wenn die Jenischen ihre sommerlichen Freiheiten mitunter sicher auch zu genießen wussten, so war das Überleben auf der Straße harte, entbehrungsreiche Arbeit und bot oft nur wenig Anlass zur Freude.
Das häufig besungene sorgenfreie und freudvolle Leben der Fahrenden war alles andere als die Wirklichkeit, sondern vielmehr ein romantisch verklärter Mythos der Sesshaften, eine eskapistische Fantasie, der sich bürgerliche Schriftsteller:innen, Dichter:innen und andere Künstler:innen mit oft träumerischer „Zivilisationsmüdigkeit“ hingaben. Da die Jenischen selbst damals so gut wie gar keine schriftlichen Quellen hinterlassen haben, dominierte die Schwärmerei der Sesshaften das Bild der jenischen Lebensweise und taucht so in zeitgenössischen Zeitungsartikeln, Reiseberichten, Gemälden, sowie heimatkundlichen und volkstümlichen Erzählungen auf. Auch wenn sie immer wieder wertvolle Einblicke und Details in die historische Realität bieten können, pendeln diese Darstellungen (nicht selten im selben Atemzug) zwischen neidischer Sehnsucht und herablassendem Spott. Die Autor:innen konnten es sich wohl nur selten verkneifen, ihre eigentlich geringschätzige Haltung zum Ausdruck zu bringen. Mit der tatsächlichen Lebensrealität der Jenischen setzten sie sich kaum je im Geiste aufrichtiger Empathie auseinander.
Das hat sich in den letzten 40 Jahren wohl gebessert: Zunehmend bemüht sich die Wissenschaft um einen objektiveren Blick und sucht nach plausiblen Erklärungen für das Phänomen des jenischen Semi-Nomadismus. Auch nicht-jenische Schriftsteller wie Thomas Sautner entwerfen ihre Romane mit größerer Einfühlsamkeit. Trotzdem schwingt noch immer ein unangenehmer Romantizismus mit. Daher bleibt es ein unbefriedigendes Bild, denn die Stimmen und Augen der Jenischen, die noch wie zu alter Zeit lebten, sind längst verklungen und erloschen. Im besten Fall jagt man Schatten und Echos hinterher.

Diese Kopie des Holzstiches von M. Schmid wurde im Nachlass von Romedius Mungenast als Teil eines Briefes entdeckt.
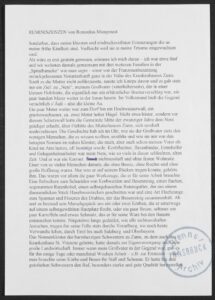
Romedius Mungenast erzählt vom Leben seiner jenischen Großeltern und der eigenen Kindheit. Außerdem löst er die spannende Frage, wie man denn einen Igel richtig zubereitet.

Gefördert vom Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlicher Dienst und Sport sowie dem Land Tirol.